Dreißig Jahre Forum Soziale Technikgestaltung beim DGB Baden-Württemberg
Rede von Martin Kunzmann, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg
Jubiläumsveranstaltung „Dreißig Jahre Forum Soziale Technikgestaltung“ mit dem Titel „Zukunft Mitbestimmung 2025 – Von der Mitbestimmung über die Anwendung der Technik zur Mitbestimmung in der Gestaltung der Technik“ am 13. Oktober 2021 im Willi-Bleicher-Haus in Stuttgart
Es ist ein besonderes Jubiläum, zu dem ich Sie und Euch heute herzlich willkommen heiße, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir feiern heute „Dreißig Jahre Forum Soziale Technikgestaltung“ beim DGB Baden-Württemberg. Es ist ein Jubiläum der Würdigung und der Wertschätzung aller ehrenamtlicher Kolleginnen und Kollegen, die das Netzwerk über 30 Jahre getragen haben. Und es ist ganz wesentlich dein Jubiläum, lieber Welf. Du bist Ideengeber, Organisator, Gesicht und Stimme des FST! Danke für diese herausragende Leistung!
Dreißig Jahre Technikgestaltung sind dreißig Jahre der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung der Arbeitswelten. Gemessen an der Geschwindigkeit, mit der sich die Digitalisierung weiterentwickelt, ist es eine Epoche. Das zeigt schon das Spannungsfeld auf: Was ist das Wissen heute noch wert, das sich ein Programmierer 1991 angeeignet hat? Wie können die Beschäftigten ein ganzes Arbeitsleben lang Schritt halten mit der technischen Entwicklung? Die Gewerkschaften sind nicht technikfeindlich.
Wir verstehen uns als Teil der Lösung, nicht des Problems. Das gilt für die Gestaltung der sozial-ökologischen Transformation genauso wie für die Digitalisierung. Aber wir haben ganz klare Anforderungen: Der Mensch muss an erster Stelle stehen. Die Technik ist lediglich ein Instrument, um Arbeit zu verbessern. Sie ist kein Selbstzweck. Genau das ist die Kernaufgabe und das Selbstverständnis des Forums: Im Geiste der Humanisierung der Arbeit rückt es die Würde des Menschen ins Zentrum des technologischen Wandels: die der Beschäftigten genauso wie die der Erwerbssuchenden. Das ist auch eine Frage der Ethik! Damit bildet das FST einen Gegenpol zu den Mark Zuckerbergs und Elon Musks dieser Welt!
Die umfangreichen Leistungen des „Forum Soziale Technikgestaltung“ haben den Frauen und Männern in Betriebs- und Personalräten, in Belegschaften und Gewerkschaften neue Wege aufgezeigt, wie Menschen den digitalen Umbau ihrer Berufs- und Lebenswelten nach ihren Interessen beeinflussen und verbessern können. Dabei galt und gilt ein Leitmotiv, auf das du, lieber Welf, sehr zu recht großen Wert legst: Technische Innovationen sind nur dann wirklich dauerhaft erfolgreich, wenn sie mit sozialen Innovationen verknüpft sind.
Hard- und Software stellen als sogenannte „harte technische Faktoren“ des Wandels nur ungefähr fünfzig Prozent der Erfolgschancen dar. Die anderen fünfzig Prozent werden von den „weichen, nichttechnischen Faktoren“ gebildet. Letztere sind die entscheidenden Punkte für das Gelingen einer tatsächlichen Innovation. Eine Datenbank kann noch so ausgefeilt sein, wenn sie nicht benutzerfreundlich ist, wird sie links liegen gelassen.
Die Motivierung der Menschen, ihre Qualifizierung, ihr Wunsch nach sozialer Sicherheit, ihre Forderung nach Gleichberechtigung, ihr Streben nach Anerkennung, Ihre Lebensplanung, ihr Ringen um Selbstbestimmung gehören mitten hinein in die Technikdebatte. Der Schlüssel zum Erfolg einer Innovation liegt nicht primär in der Einführung der Technik. Es ist vielmehr die Ermutigung der Menschen, die Prozesse in Gang setzt.
Genau das ist eure Kompetenz, liebe FSTler*innen. Ihr ermutigt, beratet und begleitet Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Fragestellungen konfrontiert sind. Auch in Berlin wird eure Arbeit gewürdigt. Ich zitiere aus der Grußadresse des DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann:
Als das „Forum Soziale Technikgestaltung“ (FST) am 7. Oktober 1991 im Stuttgarter Gewerkschaftshaus, dem heutigen „Willi-Bleicher-Haus“, gegründet wurde, trafen sich 120 Frauen und Männer aus Beschäftigtenvertretungen und Gewerkschaften. Über dreißig Jahre hinweg ist die Zahl auf über 4.650 Frauen und Männer aus Betriebs- und Personalräten sowie aus Belegschaften angewachsen. Kolleginnen und Kollegen aus Produktion und Dienstleistung, aus Verwaltung und Handwerk, aus Bildungs- und Sozialträgern, aus Kirchen und Wissenschaften führen Erfahrungs- und Fachwissen im Netzwerk zusammen. Dafür gilt dem Initiator, Mitbegründer und Leiter des „Forum Soziale Technikgestaltung“, dem Kollegen Welf Schröter, großer Dank und Anerkennung. Er steuert moderierend das Netzwerk immer wieder nach vorne in die aktuellen technologischen Herausforderungen. (Zitat-Ende)
Teil dieser Moderation waren die Einladungen an Gäste, an wissenschaftlich nahestehende Freundinnen und Freunde wie an politische Kontrahenten. So diskutierten im Forum unter anderem Joseph Weizenbaum vom Massachusetts Institute of Technology, Frieder Naschold vom Wissenschaftszentrum Berlin, Hans-Jörg Bullinger von der Fraunhofer-Gesellschaft, Menno Harms, damals Chef von Hewlett Packard, Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung, Sabine Pfeiffer heute an der Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Zu nennen sind zudem auch Ralf Reichwald von der Technischen Universität München wie auch Dieter Klumpp von der SEL-Stiftung für Kommunikationsforschung. Der frühere Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg Berthold Huber betonte in seiner Festrede zum zehnjährigen Bestehen des FST die Rolle von Bildung im digital gestützten Wandel. Zu seinem Auftritt 2001 erschienen die früheren Bezirksleiter Gerhard Zambelli und Ernst Eisenmann. Walter Riester schrieb als Bundesminister für Arbeit eine Grußbotschaft. Die Liste der Gäste und Gespräche ließe sich noch lange, lange fortsetzen.
Das „Forum Soziale Technikgestaltung“ sucht den Dialog und findet ihn. Doch diese Debatten waren nicht von Beliebigkeit geprägt. Aus pluralen Argumentationen entstanden Handlungsempfehlungen für Beschäftigtenvertretungen. In all diesen Jahren haben die Aktiven des Forums ihre Arbeit nicht leicht gemacht. Das FST forderte sicherlich auch die Gewerkschaftsmitglieder heraus, die am eingeübten Status quo festhalten wollten. Es irritierte durch Vorschläge wie etwa die Beschleunigung der Einführung digitaler Werkzeuge, die zügige Einführung von Telearbeit, die raschere Nutzung von Cloud-Plattformen. Obwohl das FST sich eindeutig für eine sozial gestaltete Digitalisierung aussprach, warnte das Forum zugleich vor einer Technikfixierung. Denn eine einseitige Technikzentrierung schwächt die Position der Beschäftigten und die Chancen der Mitbestimmung. „Wer nur von der Technik aus denkt, hat schon den Weg zum Misserfolg eingeschlagen“, betont Welf Schröter immer wieder.
In seinem Denkpapier zur „Fortschreibung der „Innovationsstrategie 2020“ der Landesregierung von Baden-Württemberg“ äußerte Welf – ich zitiere: „Das Denken von den Menschen her und das Denken von den Prozessen her muss das technikzentrierte und produktzentrierte Denken ablösen.“
Heute im dreißigsten Jahr fordert das „Forum Soziale Technikgestaltung“ die Gewerkschaften erneut heraus. Seit rund fünf Jahren arbeitet das FST an einer neuen zusätzlichen Gestaltungsstrategie. Sie wird diskutiert unter dem Motto „Der mitbestimmte Algorithmus“. Neue digitale Möglichkeiten verlangen neue Lösungen. Ich zitiere noch einmal Reiner Hoffmann:
Heute ist der Ansatz des mehrfach ausgezeichneten „Forum Soziale Technikgestaltung“ aktueller und wichtiger denn je. Mit dem herausfordernden Projekt „Der mitbestimmte Algorithmus“ mischt sich das FST selbstbewusst in die Debatte um die Zukunft algorithmischer Steuerungs- und Entscheidungssysteme – auch „Künstliche Intelligenz“ genannt – mit eigenen Anforderungen und Kriterien ein. Das FST ist ein lernendes Netzwerk. Lernend im Sinne eines menschlichen Miteinanders und der Durchsetzung der Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Erwerbssuchenden und Selbstständigen. (Zitat-Ende)
Die Kolleginnen und Kollegen im FST rufen uns auf, uns für ungewohnte Gedanken und Ansätze zu öffnen. Wir dürfen nicht hinter der Technikentwicklung herlaufen. Wir müssen den Anspruch erheben, steuernd einzugreifen. Das Projekt „Der mitbestimmte Algorithmus“ verlangt von Beschäftigtenvertretungen wie auch von den Gewerkschaften eine qualitative Erweiterung der bisherigen Interessens-, Betreuungs- und Beratungstätigkeiten. Wir müssen uns stärker einmischen. Soziale Technikgestaltung muss deutlicher im Fokus unseres Handelns liegen. Gestaltung heißt dabei, dass sich die Akteure auf gleicher Augenhöhe begegnen.
Lieber Welf, seit der Gründung im Jahr 1991 leitest Du das „Forum Soziale Technikgestaltung“. Ich will auf ein paar Punkte der vollbrachten Arbeit eingehen:
• In manchen Jahren hast Du achtzig bis hundert Vorträge in zwölf Monaten gehalten.
• In den zurückliegenden dreißig Jahren hattest Du schätzungsweise um die zweitausend öffentliche Auftritte.
• Du nimmst an nicht-öffentlichen Sitzungen von Konzern- und Gesamtbetriebsräten, von Gesamtpersonalräten, Personalräten und Betriebsräten teil.
• Du warst in Dutzenden von Technologieprojekten von Bundes- und Landesministerien, von EU und Kommunen involviert.
• Du hast weit über hundert Fachaufsätze geschrieben und mehr als anderthalb Dutzend Fachbücher herausgegeben.
• Du veröffentlichst im Blog Zukunft der Arbeit.
• Du warst mehrere Jahre E-Government-Beauftragter des DGB Baden – Württemberg.
• Du gehörtest längere Zeit dem Arbeitskreis Technologiepolitik beim DGB Bundesvorstand an.
• Du wirktest zeitweise im Gesprächskreis des Ressorts Zukunft der Arbeit beim Vorstand der IG Metall.
• Ulrike Zenke von der IG Metall Heidelberg und Du, Ihr gründeten im Jahr 2009 das regionale Betriebsrätenetzwerk ZIMT.
• Gemeinsam mit Verdi und mehreren Gesamtpersonalräten hast Du einen mehrjährigen Arbeitszusammenhang zur sozialen Gestaltung von Electronic Government und „Virtuellen Rathäusern“ initiiert.
• Im Jahr 2015 wurdest Du für das „Forum Soziale Technikgestaltung“ eigenständiges Gründungsmitglied der vom damaligen Wirtschaftsminister Nils Schmid gestarteten „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“.
• Heute unterstützt Du das vom Bundesarbeitsministerium geförderte Netzwerk „Initiative Neue Qualität der Arbeit INQA“ und bist in den INQA-Netzwerken „Offensive Mittelstand“ sowie „Offensive Gutes Bauen“ aktiv.
• Zusammen mit Partnerinnen und Partnern aus Baden-Württemberg hast Du an der Gründung des Netzwerkes „Sozialer Zusammen in digitaler Lebenswelt“ mitgearbeitet.
• Du organisierst seit bald fünfundzwanzig Jahren den Dialog „Arbeitswelt trifft Philosophie – Philosophie trifft Arbeitswelt“.
• Gemeinsam mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen hast Du beziehungsweise habt Ihr das FST-Planspiel „BetriebsratsArbeit auf Basis autonomer Software.-SYsteme BABSSY“ entwickelt und in die betriebsrätliche Bildungsarbeit eingeführt.
• Seit kurzem gibt es für das „Forum Soziale Technikgestaltung“ einen eigenen Youtube-Kanal, in dem mehr als zwanzig Video- und Audio-Dateien mit aufgezeichneten Vorträgen zu finden sind.
• Vor wenigen Tagen startete am 5. Oktober das neue Betriebsratsprojekt „PROTIS-BIT“ zur Gestaltung von Algorithmen, das von der IG Metall Heidelberg, dem Betriebsräte-Netzwerk ZIMT und dem „Forum Soziale Technikgestaltung“ getragen wird. Die Hans-Böckler-Stiftung fördert das Vorhaben.
Diese Auflistung stellt noch nicht einmal alle FST-Aktivitäten der letzten dreißig Jahre dar.
Für die Tätigkeiten wurden das FST und Du mehrfach geehrt. Für seine Verdienste um den Aufbau von Kompetenz auf dem Gebiet der Technikgestaltung wurde das „Forum Soziale Technikgestaltung“ im April 2021 mit einem Anerkennungspreis der Integrata-Stiftung Tübingen im Rahmen der Verleihung des „Wolfgang-Heilmann-Preises 2021“ ausgezeichnet.
Lieber Welf, Du hast für Betriebs- und Personalräte, für Gewerkschaften und Belegschaften wahrlich Großes geleistet und leistest es noch. Im Namen des DGB Baden-Württemberg und seiner Mitgliedsgewerkschaften möchte ich Dir von ganzem Herzen meinen besonderen Dank für Deine enorme Arbeit aussprechen.
Ebenso danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, die im „Forum Soziale Technikgestaltung“ ehrenamtlich aktiv sind und sich für Wege zu „Guter Arbeit“ einsetzen. Sie alle leisten gemeinsam wichtige Beiträge für eine bessere Arbeitswelt, für eine bessere Lebenswelt.
Die Arbeit des „Forum Soziale Technikgestaltung“ ist getrieben von dem Anspruch, die Arbeitswelt und unsere Gesellschaft humaner zu gestalten. Es geht, – um es in den Worten der Widerstandskämpferin und Architektin Karola Bloch zu sagen –, um „die Sehnsucht des Menschen, ein wirklicher Mensch zu werden“. In diesem Sinne „Glück auf!“

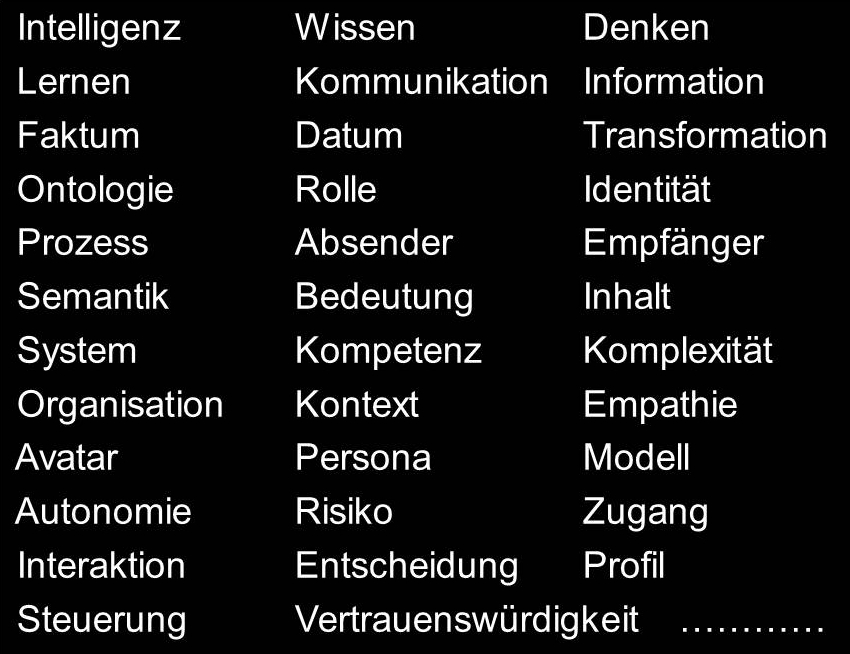 Teile der Informatik haben sich diese Begriffe angeeignet, haben sie inhaltlich gebrochen und sie danach mit einseitig informationstechnischem Inhalt aufgefüllt. Das wäre dann legitim, wenn dies aus einem lebendigen Dialog mit den Gesellschaftswissenschaften geschähe. Doch das Gegenteil ist der Fall.
Teile der Informatik haben sich diese Begriffe angeeignet, haben sie inhaltlich gebrochen und sie danach mit einseitig informationstechnischem Inhalt aufgefüllt. Das wäre dann legitim, wenn dies aus einem lebendigen Dialog mit den Gesellschaftswissenschaften geschähe. Doch das Gegenteil ist der Fall.